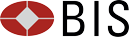BIZ-Jahresbericht 2015 - Medienorientierung
On-the-Record-Kommentare von Claudio Borio, Leiter der Währungs- und Wirtschaftsabteilung, 24. Juni 2015
Angesichts der ständigen Hektik an den Finanzmärkten und des pausenlosen Medienrummels, der sie anstachelt, würde man es kaum vermuten, aber die „wirtschaftliche Uhr" tickt langsam, viel langsamer. Die Entwicklungen, auf die es wirklich ankommt und die letztlich unser Leben prägen, verlaufen viel gemächlicher. Die „wirtschaftliche Zeit" sollte in Jahren oder Jahrzehnten gemessen werden, nicht in Minuten oder gar Mikrosekunden.
Ein Jahr ist vergangen, und in der Weltwirtschaft hat sich seit Juni 2014 nur wenig verändert. Gewiss, der Höhenflug des US-Dollars, der im Wesentlichen die tatsächlichen und die erwarteten Divergenzen der nationalen geldpolitischen Maßnahmen widerspiegelt, hat im Allgemeinen die schwächeren Volkswirtschaften auf Kosten der stärkeren begünstigt. Und der Ölpreisverfall hat alles in allem das Wachstum der Weltwirtschaft gefördert und vorübergehend den Abwärtsdruck auf die Preise verstärkt - ein echter Glücksfall. Infolgedessen hat sich das Wachstum etwas erholt und nähert sich den historischen Wachstumsraten an. Doch es ist immer noch unausgewogen. Schuldenstände und finanzielle Risiken sind nach wie vor zu hoch, das Produktivitätswachstum ist zu niedrig, und der wirtschaftspolitische Handlungsspielraum ist zu klein. Trotz der erzielten Fortschritte tut sich die Weltwirtschaft weiterhin schwer damit, die seit der Krise andauernde Malaise zu überwinden.
Das offensichtlichste Symptom dieser Malaise sind die immer noch extrem niedrigen Zinssätze. Sie sind seit außerordentlich langer Zeit außerordentlich niedrig, und zwar nach allen Maßstäben. Überdies sind die negativen Renditen an einigen Märkten für Staatsanleihen schlicht beispiellos und dehnen die Grenzen des Undenkbaren. Das jüngste Auf und Ab an den Märkten hat das Bild nicht wesentlich verändert.
Das Fortdauern außerordentlich niedriger Zinsen spiegelt die Reaktion von Zentralbanken und Marktteilnehmern auf die ungewöhnlich schwache Erholung nach der Krise wider: Auf der Suche nach gesicherten neuen Erkenntnissen tappen sie im Dunkeln. Die Zinssätze zeigen in aller Deutlichkeit, wie der Geldpolitik mit der Aufgabe, das Wachstum anzukurbeln, zu viel aufgebürdet wurde. Sie untermauern die Diskrepanz zwischen der hohen Risikoübernahme an den Finanzmärkten, wo sie Schaden anrichten kann, und der verhaltenen Risikoübernahme in der Realwirtschaft, wo zusätzliche Investitionen dringend nötig wären. Und auf längere Sicht drohen sie den Finanzsektor und die Konjunktur zu schwächen, indem sie rationale Investitionsentscheidungen behindern und zu einer dauerhaften Abhängigkeit von Schulden führen.
Der diesjährige Jahresbericht baut auf dem letztjährigen auf; er vertieft eine neue analytische Sichtweise, die uns vielleicht hilft, zu verstehen, warum all dies geschieht und was die möglichen Folgen sind. Im Mittelpunkt stehen finanzielle, mittelfristige und globale Faktoren, im Gegensatz zur herkömmlichen Fokussierung auf reale, kurzfristige und nationale Faktoren. Wir führen die gegenwärtige Malaise zu einem erheblichen Teil auf das Unvermögen zurück, in einer globalisierten Wirtschaft das Zusammenspiel des Finanzgeschehens mit der Produktion und der Inflationsentwicklung in den Griff zu bekommen. Nicht erst seit heute ist klar, dass der Auf- und Abbau enorm schädlicher finanzieller Ungleichgewichte mit den ergriffenen Maßnahmen weder in den fortgeschrittenen noch in den aufstrebenden Volkswirtschaften zu verhindern war. Diese Ungleichgewichte haben das Wirtschaftsgefüge nachhaltig geschädigt und die globale Neuausrichtung erschwert.
Aus diesem Blickwinkel betrachtet sind die über derart lange Zeit äußerst niedrigen Zinsen vermutlich keine „Gleichgewichtszinsen", die ein nachhaltiges und ausgewogenes Weltwirtschaftswachstum unterstützen würden. Sie wären demnach nicht einfach Ausdruck der gegenwärtigen Schwäche, sondern hätten diese teilweise verstärkt, indem sie kostspielige finanzielle Auf- und Abschwünge begünstigt und die nötigen Anpassungen verzögert hätten. Das Ergebnis: zu hohe Verschuldung, zu geringes Wachstum und zu niedrige Zinsen. Niedrige Zinsen erzeugen noch niedrigere Zinsen.
Der vorliegende Bericht zeigt nicht nur die neusten Entwicklungen auf, sondern führt auch die Argumentation des letztjährigen Jahresberichts in vier Punkten weiter:
Erstens untersucht er die Beziehung zwischen finanziellen Auf- und Abschwüngen und der Produktivität. Er präsentiert Belege dafür, dass finanzielle Aufschwünge zur Fehlallokation von Ressourcen führen und damit die Produktivität unterhöhlen können, und zwar sowohl während des Aufschwungs selbst als auch in der darauffolgenden Krise. Dies ist ein weiterer, bisher unterschätzter Kanal, über den Entwicklungen im Finanzsektor auf die Realwirtschaft durchschlagen.
Zweitens nimmt er die Schwachstellen in den aufstrebenden Volkswirtschaften unter die Lupe. Zweifellos geht es diesen Volkswirtschaften in mancherlei Hinsicht besser als in den 1980er und 1990er Jahren, als sie mit Krisen zu kämpfen hatten, die durch eine Verschärfung der bis dahin lockeren globalen Finanzierungsbedingungen ausgelöst worden waren. Dennoch ist Vorsicht am Platz: Es bestehen nämlich Anzeichen dafür, dass sich in den letzten Jahren finanzielle Ungleichgewichte aufgebaut haben. Und sollte es tatsächlich zu Anspannungen kommen, wären ihre Auswirkungen auf die übrige Welt viel stärker als früher, da die aufstrebenden Volkswirtschaften inzwischen erheblich an Gewicht gewonnen haben.
Drittens ist ein ganzes Kapitel des Berichts den Mängeln des internationalen Währungs- und Finanzsystems gewidmet. Statt ein nachhaltiges und ausgewogenes Wachstum der Weltwirtschaft zu fördern, besteht die Gefahr, dass dieses System das Wachstum untergräbt. Es hat außergewöhnlich lockere geldpolitische und finanzielle Rahmenbedingungen auf Länder übertragen, die sie gar nicht brauchten, und dort zur Verschärfung von Schwachstellen beigetragen. Paradoxerweise kann die kurzfristige Lockerungstendenz letztlich in eine längerfristige Kontraktion münden, wenn die finanziellen Ungleichgewichte wieder abgebaut werden.
Viertens untersucht er die Entwicklungen im Nichtbankensektor genauer. Mit der Einschränkung der Kreditvergabe durch die Banken nach der Krise kam es zu einer Verlagerung der Risiken in andere Teile des Finanzsystems. Das Fortdauern außergewöhnlich niedriger Zinsen hat die Situation noch verschärft: Diese schwächen die Finanzkraft von Versicherungsgesellschaften und Pensionsfonds und fördern ein aggressives Renditestreben, das u.a. von einer florierenden Kapitalanlagebranche umgesetzt wird. Die entsprechenden Risiken sind genau zu beobachten und zu steuern.
Wenn diese Diagnose zutrifft, dann ist für die Förderung eines robusten und nachhaltigen globalen Wachstums eine dreifache Neuausrichtung des wirtschaftspolitischen Handlungsrahmens notwendig: weg von der illusorischen Feinsteuerung der Gesamtwirtschaft auf kurze Sicht hin zu mittelfristigen Strategien, weg von der starken Fokussierung auf kurzfristige Produktion und Inflation hin zu einer systematischeren Berücksichtigung der langsamer verlaufenden Finanzzyklen und schließlich weg von der engen Doktrin, dass es genügt, das eigene Haus in Ordnung zu halten, hin zu einer Politik, die sich der kostspieligen Wechselwirkungen rein national ausgerichteter Maßnahmen bewusst ist. Dauerhafte weltweite Währungs- und Finanzstabilität sind zwei Seiten derselben Medaille.
Ein Kernelement dieser Neuausrichtung wird sein, weniger auf Nachfragesteuerungspolitik und mehr auf Strukturpolitik abzustellen. Damit sollte das schuldenfinanzierte Wachstumsmodell abgelöst werden, das als politischer und gesellschaftlicher Ersatz für produktivitätssteigernde Reformen gedient hat. Der finanzielle Spielraum, den der niedrigere Ölpreis uns derzeit verschafft, sollte unbedingt genutzt werden. Der Geldpolitik ist viel zu lange zu viel aufgebürdet worden. Sie muss Teil der Antwort sein, sie kann aber nicht die ganze Antwort sein.
Wichtiger denn je ist es, die kurzfristige Sicht durch eine längerfristige zu ersetzen. Die Finanzmärkte haben die Reaktionszeiten verkürzt, und die politischen Entscheidungsträger jagen den Finanzmärkten in immer kürzerem Abstand hinterher - eine zunehmend enge, sich selbst genügende Beziehung. Derweil bewirken der langsame Aufbau finanzieller Booms und die langen Abschwungphasen eine Dehnung der Zeit, in der die wirklich wichtigen wirtschaftlichen Entwicklungen passieren. Letztlich ist es diese Kombination von verlangsamter „wirtschaftlicher Zeit" und kürzerem Entscheidungshorizont, die erklärt, an welchem Punkt wir angelangt sind - und wie, ehe man sich's versieht, das Undenkbare zum Normalfall werden kann. Wir sollten nicht zulassen, dass es so weit kommt.